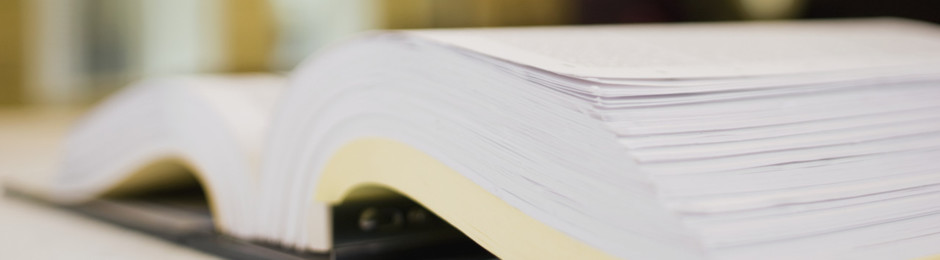Auch für Trennungseltern der bessere Weg:
Der "168-Stunden-Vertrag"
Betreuung und Unterhalt teilen
Eltern müssen nach einer Trennung ihre Aufgaben-verteilung neu regeln. Jenseits der oft sehr konventio-nellen Sichtweisen der Familiengerichte gibt es Alterna-tiven. Beide Eltern nehmen an der Betreuung teil. Beide übernehmen Verantwortung in der Alltagsversorgung und im Unterhalt.
Gemeinsame Elternschaft nach Trennung gelingt am besten mit gutem Willen. Der lässt sich vom Gesetz nicht erzwingen. Trennungseltern müssen über alle Verletzun-gen hinweg anerkennen, dass sie zwar kein Paar mehr sind, aber durch gemeinsame Elternschaft noch viele Jahre miteinander verbunden bleiben werden. In einem zweiten Schritt sollten sie anerkennen, dass sie gemeinsam für den kompletten Unterhalt der Kinder aufkommen müssen: für die vollständige Betreuung und für die vollständige Finanzierung. Wir nennen eine solche Vereinbarung den 168-Stunden-Vertrag, denn so viele Stunden hat die Woche.
Wie dieses Konto bedient wird, können Eltern bei ihrer Trennung in einer Vereinbarung niederlegen. Wer siebzig Prozent des Barunterhalts beisteuert, übernimmt vielleicht die Garantie für dreißig Prozent der persönlichen Betreuung, und umgekehrt. Die Lebensumstände können sich ändern, die Anteile auch.
Für eine Elternvereinbarung über die Anteile bei der Sorge für die Kinder müssen die beiden Aufgabenbereiche (Betreuung und Unterhalt) in ihrem jeweiligen Umfang geklärt werden. Für den Barbedarf eines Kindes kann man sich an der Düsseldorfer Tabelle orientieren. Diese wiederum richtet sich ungefähr nach dem Einkommen der Eltern (siehe die offizielle Tabelle).
Wenn Eltern ihren Barunterhalt quoteln, sollten sie sich an der Einkommensgruppe in der Tabelle orientieren, die der Summe ihrer beiden Nettos entspricht. Beispiel: Axel verdient netto 34.000 €, Miriam 22.000 €. Das ergibt ein 56.000 € und ein Monatsnetto von 4.667 €, also einen Kindesunterhalt von, je nach Alter und Umständen, 488 €.
Zu dem Tabellenbetrag sollte hinzugerechnet werden, was etwa an Kindergartenbeiträgen anfällt. Auch andere Dauerbelastungen (für Musik, Therapie oder Nachhilfe) sollten dazugerechnet werden. Nehmen wir an, die Eltern einigen sich auf einen Monatsbedarf von 600 €. Dann bilden sie -- so die heutige Rechtsprechung -- eine Quote, die jeder beisteuern muss: Zuerst ermitteln sie ihr "bereinigtes Netto". Das ist das Nettoeinkommen abzüg-lich von Kreditraten, Arbeitswegkosten, Vermögens-bildung usw.
Nehmen wir an, Axel hat danach noch 2.100 €, bei Miriam bleiben 1.500 € übrig. Dann wird der Anteil an den Unterhaltskosten errechnet aus dem, was oberhalb von 1.300 € noch übrig bleibt. Da steht Axel mit 800 € da und Miriam mit 200 €. Und in diesem Verhältnis sollen sie den Barunterhalt ihres Kindes tragen: Axel mit 80 %, Miriam mit 20 %. Die Regelung mit dem 1.300-€-Sockel, der unberücksichtigt bleibt, soll den Elternteil begünstigen, der weniger verdient. Dem besser verdienenden steht dafür ein größerer Anteil am staatlichen Kindergeld zu.
Für den Bedarf an persönlicher Betreuung gilt zumin-dest bis zum Ende der Grundschule: Keine Stunde darf unberücksichtigt bleiben. Für jede Stunde muss eine Verantwortlichkeit auch dann bestehen, wenn die reguläre Betreuung aus irgendeinem Grund ausfällt:
- wenn Schulferien sind,
- wenn das Kind Fieber hat,
- wenn die Kita geschlossen bleibt,
- wenn Opa oder Oma verreist sind.
In einem Satz: Zu regeln sind nicht nur die Stunden der persönlichen Betreuung, sondern auch der Hintergrund-dienst für die Zeiten der Betreuung durch Dritte. Beson-ders Eltern mit Nacht- oder Wochenenddienst sollten die Probleme durchspielen, die sich ergeben, wenn der reguläre Wochenplan durch unvorhergesehene Ereignisse gestört wird.
Die Eltern müssen also zwei Konten auffüllen: den Barbedarf von 600 € im Monat (der sich auf hzwei Haus-halte verteilt) und den Betreuungsbedarf von 168 Stunden in der Woche. Und wir dürfen uns diese Konten wie kommunizierende Röhren vorstellen: ein Mehr an persönlicher Betreuung zieht ein Weniger an finanzieller Verant-wortung nach sich und umgekehrt. Das Muster einer konkreten Vereinbarung finden Sie hier.
Rechtsanwalt Uwe Koch
Fachanwalt für Familienrecht
KRÜGER ANWÄLTE
Neuer Wall 26-28
20354 Hamburg
Telefon +49 40 380 822-90
Fax +49 40 84 00 99-88
E-Mail koch@ärztescheidung.de
www.krüger-anwälte.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Unsere Kanzlei in Hamburg-Mitte
Aus der Fachliteratur:
Familienrecht in der ärztlichen Behandlung
Dem Thema „Familie und Arzt“ widmet die Fachzeitschrift Familienrecht kompakt einen Beitrag. Robert Kazemi, Bonn: Medizinrecht in der familienrechtlichen Beratung, in: Familienrecht kompakt 2013, 49-53.
Anzeige
Vom Autor dieser Seite:
Uwe Koch/Dirk Otto/Mark Rüdlin:
Recht für Grafiker und Webdesigner
10. Auflage 2012, 49,90 €, Verlag GalileoPress
Weitere Informationen zu Trennung, Scheidung und Unterhalt unter:
Ein Portal des Berufsverbbands der Rechtsjournalisten e.V.